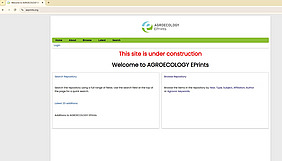Ein Living Lab (auf Deutsch oft Reallabor) ist ein Experimentierraum, in dem Praxis, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gemeinsam neue Lösungen entwickeln, erproben und bewerten. Dabei stehen Partizipation, Interdisziplinarität und Praxisnähe im Mittelpunkt.
Seit 2024 besteht für Living Labs und Forschungsinfrastrukturen im Bereich der Agrarökologie ein europäisches Netzwerk, das einen regelmässigen Austausch ermöglicht. Das FiBL ist mit seinem Versuchsnetzwerk eines der derzeit 55 Mitglieder dieses Netzwerks, das vom Ungarischen Forschungsinstitut für biologischen Landbau ÖMKi koordiniert wird.
Gastgeber des diesjährigen Netzwerktreffens Mitte Oktober war das Forschungszentrum INRAE-ETTIS, eine Einrichtung des französischen Instituts für Agrarforschung (INRAE). Es diente vor allem dem Austausch unter den Mitgliedern des Netzwerks der Agrarökologie-Partnerschaft. Thematisch standen aktuelle Entwicklungen im Netzwerk, Fragen der Sichtbarkeit sowie Strukturen für Zusammenarbeit und Entscheidungsprozesse im Vordergrund.
In Arbeitsgruppen wurden gemeinsame Prozesse diskutiert, ausserdem brachten die Partner vom kanadischen Landwirtschafts- und Ernährungsministerium zusätzliche Perspektiven ein.
Wissens- und Austauschplattform
Ein Schwerpunkt des Treffens war die Vorstellung der geplanten Wissens- und Austauschplattform (Collaborative Knowlege Platform) des Netzwerks, die in drei Bausteinen entwickelt wird:
- Aufbau des Agroecology EPrints Repository (www.aeprints.org), welches in Anlehnung an das Organic Eprints-Archiv vom dänischen ICROFS (Internationales Zentrum für Forschung zu ökologischen Lebensmittelsystemen) mit Unterstützung des FiBL aufgebaut wird. Es dient als frei zugängliche Sammlung von Materialien zur Agrarökologie.
- Das FiBL bereitet, ähnlich wie für die Wissensplattform Organic Farm Knowledge (www.organic-farmknowledge.org), Inhalte aus dem Archiv praxisnah und nutzerfreundlich auf.
- Die kollaborative Plattform (Collaborative Platform) wird einen digitalen Raum für Vernetzung, gemeinsame Entwicklung (Co-Creation) und langfristige Zusammenarbeit schaffen. Sie wird betreut von LifeWatch Eric, einer europäischen Forschungsinfrastruktur mit Sitz in Spanien, die digitale Werkzeuge und Datenplattformen für Biodiversitäts- und Ökosystemforschung bereitstellt.
Diese drei Elemente sollen eng miteinander verzahnt werden und eine lebendige und nachhaltige Infrastruktur bilden, die Wissen zu Agrarökologie dauerhaft zugänglich und praktisch nutzbar macht.
Aus der anschliessenden Diskussion ergaben sich klare Bedürfnisse wie bessere Möglichkeiten für Wissensaustausch und Vernetzung, einfache und gemeinschaftlich nutzbare Werkzeuge sowie transparente Prozesse für die Qualitätssicherung. Zudem wurde die Bündelung bereits genutzter Plattformen als wichtiger Schritt genannt, um Fragmentierung zu vermeiden und die Nutzung zu erleichtern.
Anschliessende IF-ALL-Konferenz
Direkt im Anschluss an das Netzwerktreffen fand die IF-ALL Konferenz statt, organisiert von INRAE gemeinsam mit den Partnern vom kanadischen Landwirtschafts- und Ernährungsministerium. Dieses betreibt zahlreiche Forschungs- und Innovationsprogramme, unter anderem ein grosses Netzwerk von Living Labs zur Entwicklung nachhaltiger Landwirtschaft.
IF-ALL steht für International Forum on Agroecosystem Living Labs, eine internationale Austauschplattform zur Vernetzung von Living-Lab-Initiativen weltweit. Während die erste Ausgabe der IF-ALL-Konferenz 2023 in Kanada stattfand, wurde Bordeaux nun zum europäischen Treffpunkt. Im Zentrum standen der Erfahrungsaustausch zwischen globalen Living-Lab-Netzwerken, partizipative Innovationsprozesse sowie Ansätze zur besseren internationalen Verknüpfung lokaler Initiativen. Besonderes Gewicht lag auf gemeinsamen Standards für Living-Lab-Prozesse sowie der Rolle von Kooperationen unter verschiedenen Akteur*innen bei der Beschleunigung der agrarökologischen Transformation.
Living Lab in der Praxis
Ein Programmpunkt der IF-ALL-Konferenz war die Exkursion zum Bioweinbaubetrieb Château Cormeil-Figeac, einem Mitglied des Bacchus-Living Labs, das sich dem agrarökologischen Wandel im Weinbau im Département Gironde widmet.
In diesem Living Lab werden Methoden und Praktiken erprobt, die speziell auf die Herausforderungen des Weinbaus zugeschnitten sind – etwa Bodengesundheit, Biodiversität und nachhaltige Bewirtschaftungsformen.
Autorin: Helga Willer
Weitere Informationen
Kontakt
- Helga Willer
- Bernadette Oehen
Links
- agroecologypartnership.eu: Website der Agrarökologie Partnerschaft
- agroecologypartnership.eu: Netzwerk der Living Labs und Forschunginfrastrukturen im Bereich Agrarökologie
- fibl.org: Das Projekt "Europäische Partnerschaft zur Beschleunigung der Transformation landwirtschaftlicher Systeme – Agrarökologische Reallabore und Forschungsinfrastruktur" in der FiBL Projektdatenbank
- inrae.fr: Veranstaltung "2025 International Forum on Agroecosystem Living Labs"
- siteatelier-bacchus.com: Website des Bacchus Living Labs
- agriculture.canada.ca: Living Laboratories Initiative in Kanada